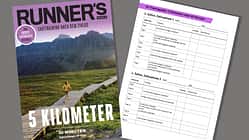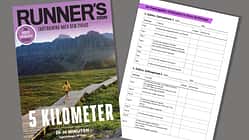Die Frauen hatten es anfangs schwer. Die Gründer der modernen Olympischen Spiele, allen voran der Franzose Pierre de Coubertin, hielten wenig bis gar nichts von der Frauen-Leichtathletik. Während die Männer schon 1912 in Stockholm in insgesamt 20 Diszipinen auf fünf Mittel- und Langstrecken um Medaillen kämpften, mussten die Frauen bis 1928 warten, bis auch sie die olympische Anerkennung erhielten. Erst durften sie nur über 100 und 800 Meter, in der Sprintstaffel, im Hochsprung und im Diskuswerfen antreten. Der 800-Meter-Lauf, den die Deutsche Lina Radke gewann, war umstritten, weil Vorläufe und Finale an aufeinanderfolgenden Tagen stattfanden.
Viele Läuferinnen waren total erschöpft, einige brachen zusammen – ein gefundenes Fressen für die konservativen Kräfte, die darin den Beweis sahen, dass Frauen tatsächlich das schwächere Geschlecht seien. Es wurde argumentiert, dass die längeren Distanzen die zarte Weiblichkeit nicht nur überfordern würden, sondern dass sie sogar zu einer Vermännlichung oder Unfruchtbarkeit führen könnten. Der Leistungssport würde den begrenzten Energievorrat verschwenden, den jede Frau für die Mutterschaft brauche. Viele medizinische Experten teilten diese Ansichten, und so entschied das IOC in Absprache mit dem internationalen Leichtathletik-Verband IAAF, die 800 Meter wieder aus dem Programm zu streichen.
Erst 1960 traute man den Frauen die 800 Meter wieder zu, 1972 dann auch die 1.500 Meter. Noch viel länger mussten die Marathonläuferinnen auf ihren olympischen Einsatz warten. Erst 1984 war es so weit, obwohl die IAAF bereits 1928 eine erste beachtliche Leistung aufgezeichnet hatte: Die Britin Violet Piercy lief im Alleingang in Chiswick 3:40:22 Stunden. 38 Jahre später wurde diese Zeit von einer andere Britin, Dale Greig, unterboten (3:27:45). Doch den eigentlichen Durchbruch brachte erst der Auftritt von Kathrine Switzer.
„Keine Frau kann Boston laufen. Wenn es eine schaffen kann, dann vielleicht du, aber du müsstest es mir vorher im Training beweisen“
Es war im Dezember 1966 in Syracuse im US-Bundesstaat New York. Die zu der Zeit 19-jährige Journalismus-Studentin Kathy Switzer war im Schneesturm unterwegs mit ihrem 50-jährigen Coach Arnie Briggs, der 15-mal den Boston-Marathon gefinisht hatte. Da sagte Briggs plötzlich: „Keine Frau kann Boston laufen. Wenn es eine schaffen kann, dann vielleicht du, aber du müsstest es mir vorher im Training beweisen.“ Und so starteten die beiden drei Wochen vor dem Boston-Marathon 1967 zu einem Testlauf über die 42 Kilometer. Am Ende fühlte sich Switzer so gut, dass sie vorschlug, noch acht Kilometer dranzuhängen.
Am nächsten Tag kam Briggs zu ihr und sagte: „Melde dich für den Marathon an, im Reglement der Amateur Athletic Union ist nichts über das Geschlecht der Teilnehmer zu finden.“ Kathrine Switzer füllte das Anmeldeformular aus und unterschrieb, wie sie das immer tat, mit „K. V. Switzer“. Nun fühlte sich auch ihr Freund Tom Miller, ein Football-Spieler und Hammerwerfer, trotz seiner 106 Kilo herausgefordert: Wenn eine Frau den Marathon laufen kann, könne er das auch. Außerdem gesellten sich noch Arnie Briggs selbst und ein Läufer aus seinem Crosslauf-Team dazu.
Dieser Zwischenfall beim Boston-Marathon 1967 veränderte die Geschichte der Frauen im Sport
Am Renntag, dem 19. April 1967, liefen die vier von Anfang an zusammen. Switzer ahnte nicht, dass sie an diesem Tag in die Geschichte eingehen sollte. „Ich lief den Marathon nicht, weil ich etwas beweisen wollte“, sagt sie, wenn man sie darauf anspricht. „Ich war bloß eine junge Läuferin, die ihren ersten Marathon laufen wollte.“
Doch dann geschah der Zwischenfall, der nicht nur ihr Leben veränderte, sondern auch die Rolle der Frauen im Sport. Lassen wir Switzer selbst erzählen: „Es war nach etwa vier Meilen. Wir hörten Gehupe, und jemand schrie: ‚Geht zur Seite, nach rechts!‘ Ein offener LKW bahnte sich den Weg durch die Läufer, gefolgt von einem Bus. Es waren Presseleute. Plötzlich verlangsamte der Fahrer das Tempo, die Fotografen begannen Bilder von uns zu schießen: eine Frau mit Startnummer inmitten der Männer! Wir lachten. Doch plötzlich stand ein Mann in einer blauen Jacke auf der Straße und zeigte mit dem Finger auf mich. Ich dachte, er sei ein Zuschauer, bis ich die blau-gelbe Schleife auf seinem Kragen erkannte und begriff, dass er zur Rennleitung gehörte.
Er hielt mich an der Schulter fest und schrie: ‚Verlass sofort mein Rennen und gib mir die Startnummer.‘ Arnie versuchte vergeblich zu intervenieren und rief: ‚Lass sie laufen, Jock, ich habe sie trainiert.‘ Dann machte Tom ein paar Schritte auf diesen Jock zu und schubste ihn so heftig, dass er im Straßengraben landete. Wir liefen weiter, aber ich hatte Angst, dass dieser Zwischenfall böse Folgen haben würde.“ Vor allem sorgte der Vorfall dafür, dass Kathrine Switzer unbedingt ins Ziel kommen wollte. „Wenn ich aufgegeben hätte, wäre das ein Triumph für Jock Semple und seine Gesinnungsgenossen gewesen.“
Nach 4:20 Stunden erreichten sie das Ziel als Trio, Schwergewicht Tom, Switzers späterer Ehemann, traf eine Stunde später ein. Am nächsten Tag waren die Fotos nicht nur im „Boston Globe“, sie waren überall.
Van Aaken als Vorkämpfer in Deutschland
Für die Frauen-Laufbewegung hatte sich seit den 50er-Jahren auch der deutsche Sportmediziner und Trainer Dr. Ernst van Aaken starkgemacht. Er war ein Verfechter des Dauerlaufs (er entwickelte die „Waldnieler Dauerlaufmethode“) und forderte schon früh die Legalisierung von Frauen-Wettkämpfen auch über längere Distanzen. 1967, nur fünf Monate nach Kathrine Switzers Lauf in die Geschichtsbücher, ließ er beim Marathon in Waldniel drei Frauen teilnehmen. Dabei realisierte Anni Pede-Erdkamp in 3:07:26 Stunden eine – damals noch inoffizielle – Weltbestzeit. 1973 führte van Aaken den ersten Marathon nur für Frauen durch und zehn Jahre später sogar einen 100-Meilen-Lauf.
Van Aakens prominenteste Athletin war Christa Vahlensieck, geborene Kofferschläger. Zwischen 1973 und 1989 gewann Vahlensieck 21 Marathonläufe, sie verbesserte zweimal die Weltbestzeit, zuerst auf 2:40:16 und dann auf 2:34:48 Stunden, und holte elf nationale Meistertitel. Mit ihren großen nationalen und internationalen Erfolgen auf der Marathondistanz und darüber hinaus hat sie den Frauen in Deutschland die Tür aufgestoßen.
Seither haben laufende Frauen einen lange nicht für möglich gehaltenen Siegeszug angetreten. In den USA, dem Land, das uns vor 40 Jahren schon die Joggingbewegung beschert hat, nehmen an den Straßenläufen heute mehr Frauen als Männer teil. Und alles begann mit Kathrine Switzer, der Frau, die 1947 im deutschen Amberg als Tochter eines amerikanischen Offiziers geboren wurde und ihr ganzes Leben dem Ziel gewidmet hat, Frauen zum Sport zu motivieren: als Läuferin, Journalistin, Autorin, Fernsehkommentatorin. Am 17. April 2017, 50 Jahre nach ihrem historischen Lauf, war Switzer, inzwischen 70 Jahre alt, wieder am Start des Boston-Marathons. Diesmal als umjubelte Trendsetterin.